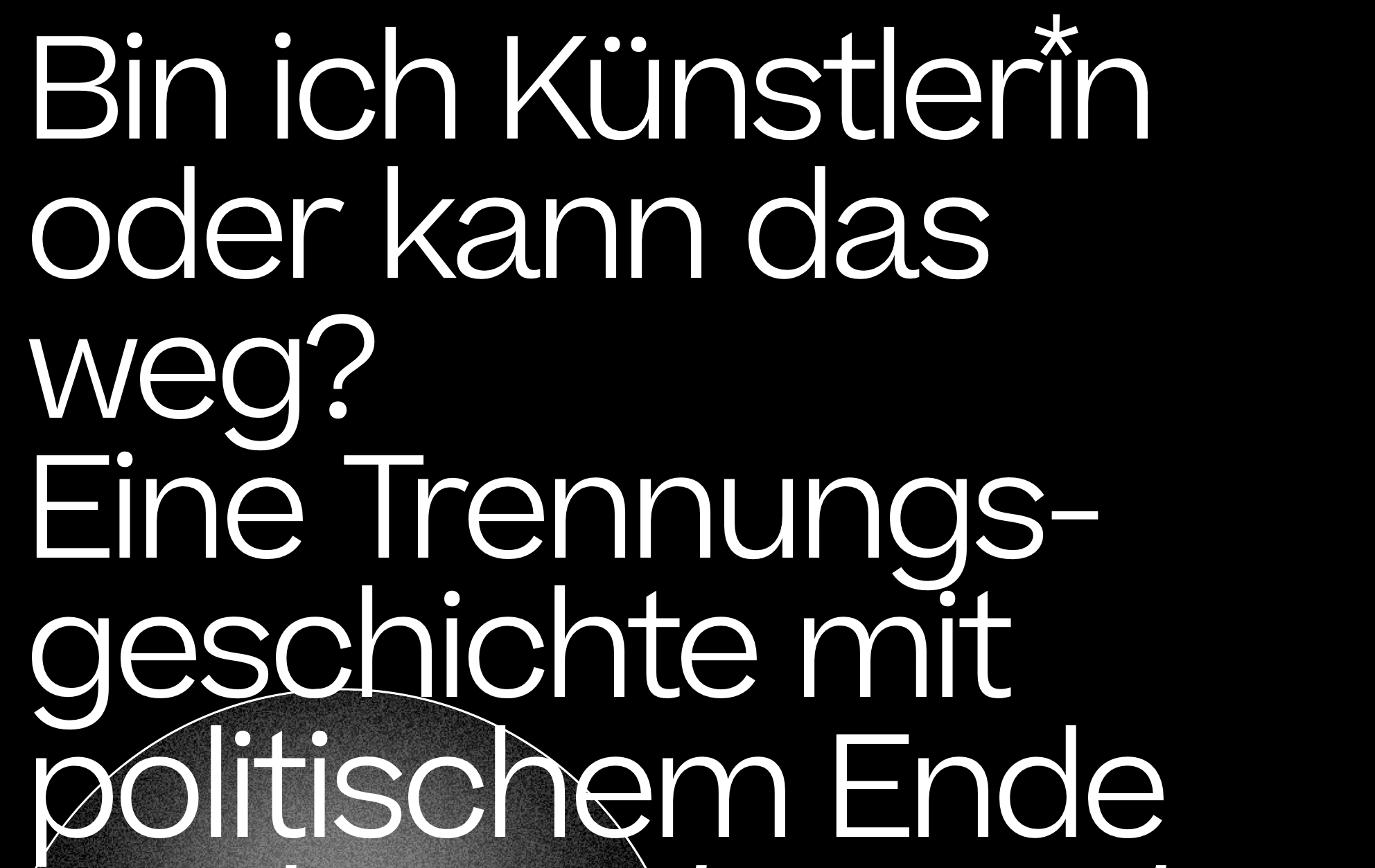Man kann alles M√∂gliche trennen. M√ľll, Ehen, Spreu vom Weizen, mal ist es schwierig, mal ganz leicht, so wie das Blatt Klopapier, dass man von der Rolle rei√üt. √Ėl und Wasser trennen sich sogar zuverl√§ssig und ganz reibungslos freiwillig.
Auf Seiten der Erkenntnistheorie (Was kann ich wissen?) formulierte George Spencer-Brown 1969 sein logisches Paradigma: ‚ÄěDraw a distinction!‚Äú, mach eine Unterscheidung! Er meinte damit folgendes: Immer dann, wenn wir etwas bezeichnen, entschlie√üen wir uns dazu, dieses¬†eine¬†durch unsere Bezeichnung von¬†allem anderen¬†zu trennen. In der t√§glichen Praxis geschieht das meist unbewusst. Wer A sagt hat nicht B gesagt, ob aus Gewohnheit oder in voller Absicht. Wer etwas als Kunst bezeichnet, trennt das Bezeichnete von Maschinenbau, Ehe und Klopapier, und was Menschen sonst noch tun und brauchen. Aber ‚Äď und das ist das Entscheidende ‚Äď wir trennen nicht Kunst von Maschinenbau, weil beide dem Wesen nach verschiedene Dinge sind und weil das allen Sprechenden und Zuh√∂renden immer schon klar war, sondern, so Spencer-Brown,¬†wir nehmen diese Trennung vor, indem wir eine Unterscheidung¬†treffen¬†(to draw, vergl. ‚Äěperformativ‚Äú). Wir machen uns also stets auf eine Weise verantwortlich, sozusagen epistemologisch haftbar, wenn wir uns entscheiden, etwas so oder so zu bezeichnen, etwas von etwas zu trennen, sagen: dies ist das, und das da ist etwas anderes. Bis jemand kommt und seine Hochzeit oder sein Klo zur Kunst erkl√§rt ‚Äď dann stehen wir dumm da mit unseren Unterscheidungen und m√ľssen nachbessern, m√ľssen¬†anders trennen, vielleicht ganz bewusst anders entscheiden. Dann schl√§gt mitunter die Stunde der Theorie.
Manche Unterscheidungen k√∂nnen ganz reibungslos ablaufen, so wie die zwischen Fl√ľssigkeiten verschiedener Molekularstruktur, andere k√∂nnen indes schmerzhaft und konfliktreich abgehen, oder schlicht knifflig sein. Wer Schwarz von Wei√ü trennt, liegt beim Schach ganz richtig, sind aber Menschen gemeint, wird es im Diskursraum hitzig. Man sollte also aufpassen, wen und was man von wem und was trennen will, unterscheiden will, absondern will ‚Äď und warum. Das macht das Trennen zum Politikum.
Kann man sich vor der Kunst trennen?
Man kann etwas von etwas trennen, zum Beispiel bewusste von unbewussten Handlungen, oder man kann¬†sich¬†von etwas trennen, zum Beispiel von einem Buch, das man nie mehr lesen wird und verschenkt. Manchmal f√§llt auch beides zusammen: Man unterscheidet anders als zuvor und beschlie√üt zugleich (oder daraufhin), etwas loszulassen. Der geliebte Freund erscheint pl√∂tzlich als ekliger L√ľgner. Man sieht ihn fortan nie mehr wieder.
In einem besonderen Fall nun wird das alles ausgesprochen spannend. Bei der Frage n√§mlich, ob man die Kunst verlassen kann. Ich m√∂chte Sie gerne einladen, mit mir in diese Frage einzutauchen, denn sie birgt ungeahnte Fr√ľchte, von denen manche am Ende bitter sind, einige aber auch s√ľ√ü. Und falls Sie gerade dar√ľber nachdenken, Ihren Partner zu verlassen oder Ihren Job zu k√ľndigen, oder schlicht das Handtuch zu werfen, dann bleiben Sie bei mir. Ich hab‚Äė vielleicht was f√ľr Sie.
Fangen wir mit einer einfachen Frage an: Kann man sich vor der Kunst trennen? Als erstes w√ľrde ich dann unterscheiden, dass mich hier nicht interessiert, was geschieht, wenn eine Sammlerin ihre Kunstsammlung verbrennt. Das √§ndert f√ľr mich nicht viel, au√üer, dass die Kunst futsch ist und man das nicht tun sollte. Mich interessieren nicht die Dinge, die Werke, von denen man sich trennen k√∂nnte. Ebenso wenig interessieren mich im engeren Sinne die Begriffe, die Kunst und anderes unterscheiden. Den Kunstbegriff, das hat das 20. Jahrhundert gezeigt, sollten wir pragmatisch als eine ziemlich breite Bezeichnung f√ľr alles M√∂gliche betrachten, das Personen mit diesem Begriff in Verbindung bringen. Mich interessieren hier stattdessen die k√ľnstlerische Praxis und das Rollenmodell ‚ÄěK√ľnstler*in‚Äú. Kann man sich von denen trennen? Und wenn ja ‚Äď was man ja vermuten w√ľrde, denn warum nicht ‚Äď, wie genau spielt sich das ab? Was wissen wir eigentlich dar√ľber?
Es wurden Kilometer von B√ľchern geschrieben, wie, warum, auf welchen Wegen K√ľnstler*innen zu K√ľnstler*innen wurden und werden, was k√ľnstlerische Praxen ausmacht, wie man sie erlernt, performt, zum Beruf macht, perfektioniert, eingrenzt oder √∂ffnet, wie sie sich im Laufe der Historie immer wieder gewandelt haben, was ihre Zukunft sein k√∂nnte. Eine Recherche, die ich ab 2001 anstrengte und die alsbald in eine (abgebrochene) Doktorarbeit1¬†m√ľnden sollte, zeigte, dass (zum damaligen Zeitpunkt) jedoch kein einziges Buch dar√ľber geschrieben worden war, wie eine k√ľnstlerische Praxis¬†endet. Nicht einmal ein nennenswerter Essay. Wie konnte das sein? Jeder kennt Geschichten √ľber Hochzeiten und Scheidungen, neue Jobs und K√ľndigungen, Krieg und Frieden, zerbrochene WCs und Rohrbr√ľche. Vieles, fast alles, das schon ist oder frisch beginnt, hat auch ein Ende, und zu all diesen Enden gibt es viel Literatur. Das Ende einer k√ľnstlerischen Praxis, oder wie man in soziologischer Perspektive erg√§nzen muss: das Ablegen der K√ľnstlerrolle, die Trennung von Stand, Status, Zuschreibung und Akzeptanz als K√ľnstler*in, ausgerechnet das sollte bislang nicht Gegenstand genaueren Nachdenkens gewesen sein? Ich war verdutzt.
Dann stie√ü ich auf die Giotto-Legende, die ich aufschlussreich fand. Wir befinden uns in der Fr√ľhrenaissance. Der Maler Giotto ist zu Ruhm und Reichtum gelangt und Giorgio Vasari, einer der ersten Kunsthistoriker, schreibt seine Geschichte auf, die sich bald verbreitet. Giotto sei ein junger Hirtensohn gewesen, der, w√§hrend er Schafe h√ľtete, Zeichnungen seiner Schafe auf Stein anfertigte. Ein K√ľnstler namens Cimabue sei bei einem Spaziergang vorbeigekommen und habe dem Jungen √ľber die Schulter geschaut, was er da tue ‚Äď und sogleich die au√üergew√∂hnliche Qualit√§t und Wahrhaftigkeit seines Strichs erkannt. Cimabue nimmt ihn mit und l√§sst ihm eine Ausbildung zuteilwerden. Aber die Gabe seiner K√ľnstlerschaft ist nicht m√ľhsam erworben, nicht antrainiert und entspringt weder einem hohen sozialen Satus, noch handwerklicher Geschicklichkeit allein, nein. Sein Talent wurde ihm in die Wiege gelegt!
Mit dieser Erz√§hlung vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Giotto wird zum Prototyp des K√ľnstlergenies. Die Legende erhebt ihn √ľber den Stand des Handwerkers, den auch K√ľnstler neben Schreinern und Schmieden vordem innehatten. In der Hierarchie manueller kreativer Berufe wird mit Giotto der K√ľnstler ‚Äď am Ausgang des Mittelalters ‚Äď abgesondert von den profanen T√§tigkeiten anderer Schaffender. Das besondere, einzigartige, liegt ihm im Blut, es ist ein Segen, ein g√∂ttliches Privileg, eine unersetzliche Eigenart, ja: was er tut ist Sch√∂pfung (Vergl. ‚Äěk√ľnstlerisches Schaffen‚Äú, ein Begriff, der mir immer suspekt war.). Aber nun Achtung: Wer, der in der Hierarchie der Schaffenden einmal die von Konkurrenten und Institutionen besonders stark reglementierten Weihen solch hehrer K√ľnstlerschaft erh√§lt, w√§re wohl je auf die Idee gekommen, sie wieder abzugeben? Wer trennte sich wohl von einer derart herausgehobenen Position, wie sie das von Kirche, K√∂nigsh√§usern und Fachkollegen anerkannte K√ľnstlergenie einnimmt? Denn von dort aus f√ľhrte der Weg nur in eine einzige Richtung: wieder hinab in die Niederungen des einfachen, profanen Handwerks.
Im Angesichte allerh√∂chster Weihen, gottgegebener Eingebungen, sch√∂pfungsgleichem Erfindungsreichtum und un√ľbertragbarer Individualit√§t eines einzigartigen Subjektes, das bei Hof, Klerus, und aufstrebender Unternehmerschaft Zuspruch und Auftr√§ge erh√§lt, erscheint es nachgerade absurd, sich auszumalen, warum und wie man ein solches Rollenmodell wieder in W√ľrde loswerden sollte, und warum in alles in der Welt das erstrebenswert w√§re. ‚ÄěDanke, ich trenne mich von der Kunst und mache jetzt was anderes.‚Äú, das kommt in diesem Spiel nicht vor, ja es w√§re ein Sakrileg.
Aura des Besonderen
Nun ist ja seit der Fr√ľhrenaissance einige Zeit vergangen und der Geniekult, der √ľber die Epoche der Romantik auch die Epoche der Moderne gepr√§gt hat, ist vielfach kritisiert und dekonstruiert worden (K√ľnstler*innen sind Leute, die auch nur ihre Dinge tun, so wie auch alle anderen Menschen ihre Dinge tun, nur halt je ein bisschen verschieden. Kurz: nehmt die Trennung zwischen dem einen und dem anderen nicht zu ernst.). Trotzdem hallt die alte Unterscheidung, was K√ľnstlertum im Kern ausmache und was nicht, bis heute nach. K√ľnstlersein, das klingt nach wie vor nicht wie eine Entscheidung (Papa, ich werde Arzt.), sondern wie ein Schicksal (Kind, Du bist etwas ganz Besonderes!).
Ich √ľberzeichne, gewiss, aber w√ľrden Sie mir widersprechen, dass K√ľnstlertum auch heute noch von der Aura des Besonderen umgeben ist, dass in der Rhetorik offizi√∂ser wie auch alltagsprachlicher Stimmen manchen (wenigen) Menschen in die Seele oder in die Hormone gelegt zu sein scheint und andern nicht? Und w√ľrden Sie mir zustimmen, dass, wer heute Kunst studiert, ‚Äěes‚Äú aber nach dem Studium nicht schafft, in den Augen der Gesellschaft kein Ansehen genie√üt (H√§ttest besser gleich was Vern√ľnftiges machen sollen!)? Oder anders gefragt: Was denn h√§tten Studierende des Fachs Kunst erworben, das in den Augen der Gesellschaft anerkennungsw√ľrdig und wertvoll w√§re f√ľr den Fall, das keine k√ľnstlerische Karriere daraus wird? Ahnen Sie mit mir, dass diese Frage vielerorts Ratlosigkeit nach sich ziehen oder bestenfalls Floskeln hervorbringen wird, wie: Nun ja, Kreativit√§t wird √ľberall gebraucht. Toll, dass Du mit Bleistift und Kamera umgehen kannst. W√ľrde man sich gerne √∂ffentlich selber daf√ľr r√ľhmen, einmal K√ľnstler*in¬†gewesen zu sein? W√§re am Kneipentisch die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, den Kommentar zu kassieren: Und was ging schief?
Dabei ist rein statistisch klar, dass es weitaus mehr ehemalige K√ľnstlerinnen und K√ľnstler geben muss als aktuell praktizierende ‚Äď nimmt man als Ma√üstab die vielzitierte Zahl von drei bis f√ľnf Prozent aller Absolvent*innen von Kunsthochschulen, die von ihrer Kunst dauerhaft leben k√∂nnen (Die Zahl ist √ľbrigens quatsch, aber das ist ein anderes Thema.). Und der Rest? Ist der gescheitert? Jedenfalls gilt die k√ľnstlerische Praxis √ľblicherweise nicht als Leiter, die man fortwirft, nachdem man auf ihr eine n√§chste Ebene erklommen hat, so wie etwa die politische Praxis oftmals zu einer Leiter wird, auf der man einen lukrativen Posten in der freien Wirtschaft ergattert. Es ist auch nicht schlimm, √Ąrztin zu sein und dann das Pferd zu wechseln um Reisereportagen zu schreiben ‚Äď oder umgekehrt ‚Äď wenn es sich nun mal so ergab. Warum sich nicht ver√§ndern? Mit einer solchen Biografie kommt man durchaus sogar ins Radio. Aber kennen Sie K√ľnstler*innen, die man daf√ľr lobte, √Ąrzt*innen oder Reisereporter*innen geworden zu sein? Ich nicht. Aber ich hoffe, der Tag wird kommen.
Drei Arten, etwas nicht zu tun 
Manche Trennungen widerfahren einem ohne eigene Absicht, andere f√ľhrt man willentlich herbei. Sich von der eigenen K√ľnstler*innenrolle unwillentlich zu trennen, weil Anerkennung ausbleibt, das Geld knapp wird, oder aus anderen Gr√ľnden, die Menschen dazu bringen, ihre K√ľnstlerlaufbahn abbrechen zu m√ľssen, das geschieht millionenfach und soll hier ausgeklammert bleiben. Denn mich interessiert der andere Fall: Wenn die Trennung von der eigenen K√ľnstler*innenrolle eine willentliche und bewusste Entscheidung ist, obwohl die Karriere ganz gut l√§uft, die Anerkennung da ist, man also weitermachen kann,¬†es aber nicht will.
Doch auch in diesem Fall ‚Äď Draw a distinction! ‚Äď muss man genauer hinschauen. Denn nicht jede Trennung ist auch eine,¬†beziehungsweise¬†ist manche Trennung ein echter Schlussstrich, w√§hrend andere es nicht sind. Sich von einer Praxis zu trennen hei√üt ja nichts anderes, als etwas nicht mehr zu tun. Aber es gibt unterschiedliche Weisen, etwas nicht zu tun, und aus Performanz- und Theatralit√§tstheorien wissen wir, dass auch das Nichthandeln ein Handeln, das Nichtstun oder Nicht-tun eine Praxis sein kann. Und auch wenn K√ľnstler*innen zu Kurator*innen oder Galerist*innen werden, ist es wenig sinnvoll von einer Trennung zu sprechen, denn meist ist es lediglich ein Rollenwechsel innerhalb der Kunstwelt, das pl√∂tzliche oder schleichende Ver√§ndern einer Praxis, das Verschieben des Fokus. Damit wir also etwas genauer werden und verschiedene Trennungen von der Kunst vern√ľnftig trennen k√∂nnen, habe ich mir drei Unterscheidungen ausgedacht.
Es gibt das¬†ostentative k√ľnstlerische Nichthandeln, wobei ostentativ so viel hei√üt wie: zur Schau stellen. Davon gibt es jede Menge. John Cages Auff√ľhrung¬†4‚Äô33¬†in Woodstock 1952 ist ein Klassiker. Er setzt sich ans Klavier und tut ‚Äď nichts. Der Skandal ist vorprogrammiert. Heute ist Cage weltber√ľhmt, weil er die Aufmerksamkeit auf den Raum, die Stille, das R√§uspern im Publikum¬†und so weiter¬†lenken wollte, anstatt auf das Klavierspiel, was k√ľnstlerische Arbeitsweisen erweitert und bereichert hat. Falls Sie sich fragen, wozu dann noch das Klavier auf der B√ľhne, wenn er es gar nicht spielte: eben darum, um sich von ihm trennen zu k√∂nnen, um es nicht zu benutzen. Einfach nur auf einem Stuhl sitzen funktioniert nicht. Erst das Klavier macht klar, dass es um Musik geht, mindestens um Akustik. Ein anderes Beispiel ist die¬†Disappearing-Performance von Chris Burden aus dem Jahr 1971. Wie der Titel schon sagt, verschwand der K√ľnstler f√ľr eine Weile, das Werk besteht aus der Schreibmaschinennotiz, dass er weg war.
Dann gibt es das¬†kommunikative k√ľnstlerische Nichthandeln. W√§re John Cage gar nicht erst zu dem Konzert erschienen, das er angek√ľndigt hatte, h√§tte er in diese Kategorie geh√∂rt. Ein Klassiker zu diesem Thema ist das ‚ÄěSchweigenDuchamps‚Äú. Jahrelang produzierte Marcel Duchamp keine Arbeiten und die Welt wunderte sich, was los ist. W√§hrenddessen aber blieb er ein Akteur im Kunstfeld, kommunizierte vielfach, schrieb Briefe, lie√ü von sich wissen, hatte Macht, war involviert. Gerade aber weil er sich vermeintlich von der k√ľnstlerischen Praxis trennte, bekam er Aufmerksamkeit f√ľr sein k√ľnstlerisches Nichtstun und damit f√ľr seine Person, deren Verhalten Fragen aufwarf. Auch ein anderer Fall ist interessant. Die Amerikanerin Cady Noland, eine K√ľnstlerinnenlegende, deren Arbeitsschwerpunkt in den 1980er und 1990er Jahren lag, stoppte die Werkproduktion, untersagte jegliche Ausstellung ihrer Arbeiten und galt gemeinhin als Aussteigerin. Was weniger Menschen wissen ist, dass Cady Noland im Hintergrund √§u√üerst aktiv blieb. Bis heute kontrolliert sie die Sichtbarkeit ihres Ňíuvres wo sie kann. Geht eine alte Arbeit in eine Auktion, bei der viele Millionen daf√ľr geboten werden, baut sie sie, wenn m√∂glich, selber auf und verschwindet sofort wieder. Ber√ľchtigt sind die zahlreichen Gerichtsverfahren, die sie anstrengte, um Arbeiten, die etwa Schaden gelitten hatten oder restauriert worden waren, aus dem Verkehr zu ziehen und ihnen die Authentizit√§t abzusprechen. Der Autor war selber Ziel eines solchen juristischen Aktes und hatte 2011 die K√ľnstlerin eines morgens am Telefon, die mit physischer Gewalt drohte, falls er ihre Werke nicht sofort aus der von ihm kuratierten Ausstellung entfernen w√ľrde. Kurz: Cady Noland stieg nicht aus der Kunst aus. Sie kommuniziert stetig und auf die entschiedenste Weise mit anderen Mitspieler*innen in der Kunstwelt, und verfolgt dabei klare Ziele. Und erinnern Sie sich an Maurizio Cattelans Ank√ľndigung, er habe genug und werde aus der Kunst aussteigen? Das war 2012. Mich rief das¬†Monopol Magazin¬†an und fragte, ob ich das kommentieren wolle. Ich sagte: Lasst euch nicht foppen. Cattelan steigt nicht aus, der inszeniert sich nur. So kam es dann auch.
Der Ausstieg aus der Kunst
Vom ostentativen und vom kommunikativen Nichthandeln unterscheidet sich das¬†radikale k√ľnstlerische Nichthandelndadurch, dass nicht nur nicht mehr k√ľnstlerisch gearbeitet wird, sondern dass man an den sozialen Spielen, den Kommunikationen, der √Ėkonomie, den Veranstaltungen und Ereignissen der Kunstwelt nicht l√§nger teilnimmt und vollst√§ndig aus dieser Welt verschwindet. Die Br√ľcken abbricht. Weg ist. Weg weg. Das und nur das ist in meinen Augen, was man sinnvoller Weise als einen Ausstieg aus der Kunst bezeichnen kann: das vors√§tzliche Ablegen der K√ľnstlerrolle. Meine Definition lautet so:¬†Ein Ausstieg aus der Kunst liegt dann vor, wenn ein Akteur zu einem fr√ľheren Zeitpunkt im Kunstfeld sichtbar war und zu einem sp√§teren Zeitpunkt nicht mehr, und dies so wollte.¬†Jetzt m√∂gen Sie die Schultern zucken und sagen: Ja und? Das ist jetzt die Pointe? Warum soll das interessant sein? Nun, interessant finde ich dabei dreierlei.
Ich sagte oben, dass so wenig dar√ľber bekannt ist, wie und warum k√ľnstlerische Praxen an ein Ende gelangen. Dann habe ich so lange Unterscheidungen getroffen und das eine vom anderen getrennt, bis nun ein bestimmtes, und vielleicht auch interessantestes, Ende solcher Praxen klar umrissen ist. Bemerkenswert finde ich dabei, dass K√ľnstler*innen ja gerne als Aussteiger*innen betitelt werden, womit dann oft gemeint ist, dass sie nicht der sozialen Norm entsprechen oder irgend etwas tun, das als Grenz√ľberschreitung gilt. Dass ihre Grenz√ľberschreitung, ihr Aussteigertum, aber auch darin liegen k√∂nnte, dass sie¬†aus der Kunst¬†aussteigen, scheint lange Zeit unbedacht geblieben zu sein, ja vielleicht unvorstellbar (vergleiche Giotto). Aber dieser Umstand geh√∂rt in unser K√ľnstler*innenbild hinein. Ich finde, wir k√∂nnen keine Kunstgeschichte schreiben, die Leute au√üer Acht l√§sst, die es vorgezogen haben, in dieser Geschichte nicht mehr vorzukommen, obwohl sie es h√§tten k√∂nnen.
Auf der Suche nach F√§llen, die obiger Definition entsprechen,¬†beziehungsweise¬†die mich dazu brachten, sie so zu formulieren, stie√ü ich mit einer gewissen Regelm√§√üigkeit auf K√ľnstler*innen, die sich in historischen Umbruchzeiten politisch engagierten und in deren Biografien erkennbar ist, dass sie sich von der Kunst abwandten, weil sie ihr nicht zutrauten, ausreichend Relevanz zu besitzen, um zum gesellschaftlichen Wandel beizutragen. Ich fand solche F√§lle von der Mitte des 18. Jahrhunderts aufw√§rts, geh√§uft in Revolutionszeiten und stets wirkte es auf mich, als seien solche Ausstiege Statements, die im Bereich der Institutionskritik relevant w√§ren, dort also, wo man sich fragt, ob die gesellschaftliche Konstruktion von Kunst, so wie wir sie uns im Laufe der Geschichte gebastelt haben, eigentlich Sinn macht oder ver√§ndert geh√∂rte. Es ist eine¬†der¬†zentralen Fragen, die hier immer wieder gestellt wurde: Was kann Kunst? Ist das wichtig, richtig? Kann das weg? Sollte das weg? Sollte ich besser etwas anderes tun? Tats√§chlich haben relevante K√ľnstler*innenpers√∂nlichkeiten immer wieder diese Fragen gestellt, und manche davon haben sich mit ihrer Antwort so positioniert wie Charlotte Posenenske. Im Mai 1968 ver√∂ffentlichte die Bildhauerin, deren Werk lange fast verschollen war, bis es in den 2000er Jahren posthum als Klassiker der deutschen Minimal Art rehabilitiert wurde, unter anderem auf der documenta 12, ein Statement in der amerikanischen Kunstzeitschrift¬†Art International, das mit folgenden Worten endet: ‚ÄěEs f√§llt mir schwer, mich damit abzufinden, dass Kunst nichts zur L√∂sung gesellschaftlicher Probleme beitragen kann.‚Äú Im Jahr darauf trennte sich Posenenske von der Kunst, studierte fortan Soziologie und wurde bis auf Weiteres von der Kunstwelt vergessen. Ich k√∂nnte viele F√§lle aus den vergangenen 200 Jahren nennen, die ungef√§hr vergleichbar sind. Ihnen allen ist eines gemeinsam: Sie kritisierten die gesellschaftliche Rolle der Kunst und die eigene Rolle als K√ľnstler*in, und diese Kritik kulminierte in der Konsequenz, sich von der Kunst als Handlungsfeld zu verabschieden. Man k√∂nnte also durchaus auf die Idee kommen, in solchen Kunstausstiegen eine radikale ‚Äď vielleicht die radikalste ‚Äď Form von Institutionskritik zu sehen, n√§mlich eine fundamentale Kritik am System Kunst¬†insgesamt. Und das bringt mich zum n√§chsten und letzten Punkt.
Der Umstand, dass es keine Rezeption solcher Kritik gab, dass das, was ich f√ľr Statements halte, n√§mlich das begr√ľndete Niederlegen einer k√ľnstlerischen Praxis aufgrund fundamentaler Zweifel an den Bedingungen und M√∂glichkeiten dieser Praxis, so lange nicht gesehen und geh√∂rt wurde, spricht B√§nde dar√ľber, was die Kunstwelt in ihrer Wahrnehmung und Kommunikation verarbeiten kann und will, und was nicht, wer da vorkommt und wer nicht, was man sehen will und was man nicht sehen will. Es gibt aber, und damit komme ich allm√§hlich zu Schluss, nat√ľrlich ein Handicap bei der Sache: Wenn jemand der Kunstwelt seinen R√ľcken kehrt und f√ľrderhin nimmer gesehen wird, f√§llt es freilich nicht ganz leicht, diesen Schritt zu rezipieren und etwa auf die Idee zu kommen, eine Doktorarbeit dar√ľber zu schreiben, dass da jemand war, der jetzt nicht mehr da ist. Es ist verst√§ndlich, dass Kunsthistoriker*innen nicht viel Leidenschaft daf√ľr entfalteten, sich mit K√ľnstler*innen zu befassen, die keine mehr sind. Es ist ein bisschen kontraintuitiv f√ľr Wissenschaftler*innen, sich etwas zuzuwenden, das weg ist. Gleichzeitig scheint mir das aber auch ein Problem der Profession zu sein, denn im Leben tun wir so etwas ja massenhaft. Jede*r, der/die eine schwierige, vielleicht schmerzvolle Trennung von einer Partnerin oder einem Partner durchlebt hat, wei√ü gut, wieviel man dar√ľber nachdenkt, warum jemand gegangen ist, was die Motive waren, wie lange sich das schon abzeichnete, ob man Schuld daran war oder Grund hat, richtig sauer zu sein. Warum sollte man sich das nicht mit gleicher Tiefe fragen, wenn sich jemand, den man sch√§tzte, von der Kunst getrennt hat? Auch von uns getrennt hat, falls wir Angeh√∂rige der Kunstwelt sind. Das sollte nicht nachdenklich machen? Ich finde, es sollte. Es ist ein Spiegel f√ľr uns. Es beschreibt ein St√ľck des Ortes, an dem wir sind, wenn sich jemand entschloss, nicht l√§nger an diesem Ort zu sein.
Und zum guten Schluss will ich das ganze nun dramatisieren! Denn man k√∂nnte auf folgenden Gedanken kommen: Wenn man so wenig dar√ľber wei√ü, wer sich wann und warum von einer k√ľnstlerischen Praxis trennte, weil er / sie / es nicht l√§nger an die Relevanz dieser Praxis glaubte oder sonstige gute Gr√ľnde hatte, ihr nicht das zuzutrauen, was man sich erhoffen w√ľrde, und also aus dem Blickfeld der Kunstweltler*innen auf nimmer wiedersehen verschwand ‚Äď was k√∂nnen wir dann eigentlich davon wissen, wie oft so etwas geschieht? Sind das Einzelf√§lle? Was, wenn es ein Massenph√§nomen w√§re? Was, wenn gar die Kunstwelt nur aus denjenigen Menschen best√ľnde, die sich¬†nicht¬†dazu entschlossen haben, dieser Welt aus guten Gr√ľnden Adieu zu sagen? Was, wenn wir der Rest sind? Ein unkritischer Rest, der sich einfach nicht trennen kann und will von einer Praxis und einem Leben, die Millionen, ja Milliarden anderer Menschen eher entt√§uschend oder zumindest wenig vielversprechend finden, weshalb sie es sogar vorzogen, gar nicht erst¬†einzusteigen¬†in die K√ľnstler*innenrolle und uns also alleine lie√üen, bevor wir sie √ľberhaupt sehen und kennenlernen konnten, damit sie uns erz√§hlen, was sie an unserem Tun und Dasein problematisch finden?
Alexander Koch
Erschienen in: Martin Köttering (Hg.), Lerchenfeld Nr. 57, Hamburg 2021
1¬†Kunst verlassen #1, Ausstellung in der Galerie der Hochschule f√ľr Grafik und Buchkunst, Leipzig, 2001; GENERAL STRIKE, Grundlagen zu Theorie und Geschichte des Kunstausstiegs, KOW ISSUE 8, Berlin, 2011